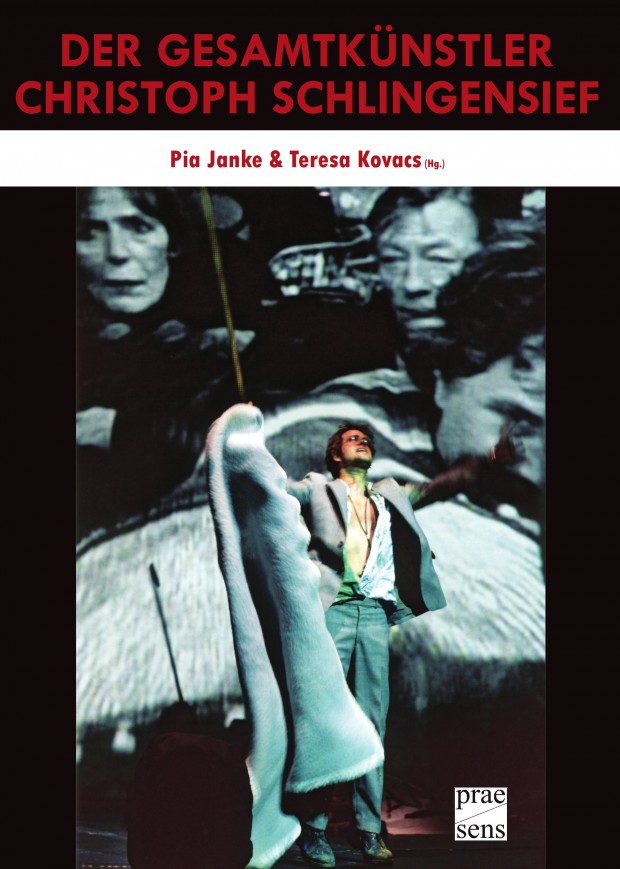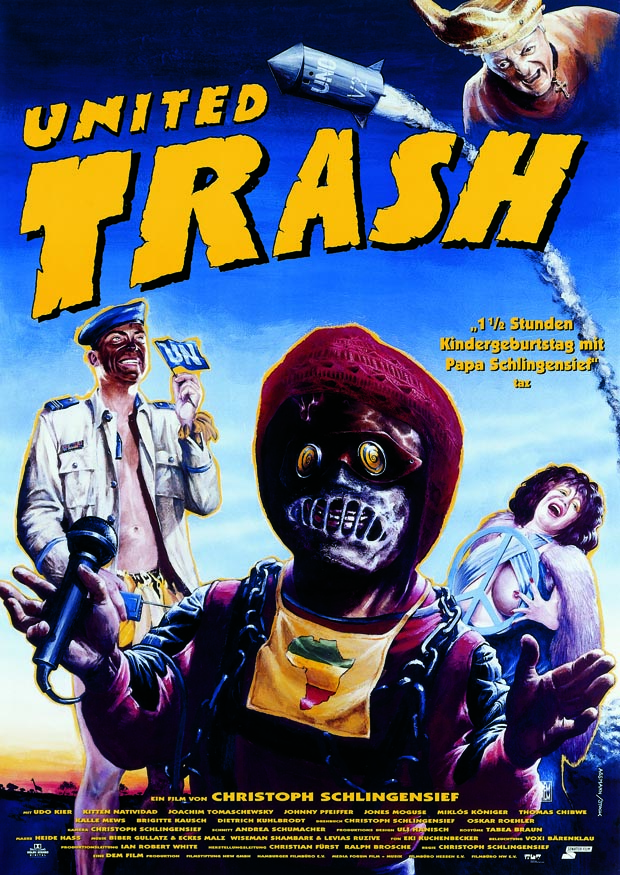Sonntag, 22. August 2010, acht Uhr. Von der gestern eingetroffenen, letztlich dann doch überraschenden Todesnachricht benommen, schaue ich nach nur wenigen Stunden Schlaf in die Morgensonne, kleiner großer Skorpion-Bruder, und komme in meiner Trübsal nicht weiter. Wie gelähmt denke ich immer wieder, was uns Bazon Brock ins Stammbuch geschrieben hat: Der Tod, diese verdammte Scheiße, muss endlich aufhören. In wenigen Wochen sollte Dein 50. Geburtstag stattfinden, das Operndorf-Projekt in Afrika wollte weitergeführt werden und natürlich hattest Du gehofft, im kommenden Jahr höchstpersönlich in Venedig sein zu können, um dort den deutschen Biennale-Pavillon zu bespielen. Eine Ehre wäre es für Dich gewesen, die Nation zu vertreten und sie zugleich zu irritieren, zu fordern, zu provozieren.
Jetzt muss sich Susanne Gaensheimer, die Kommissarin des Deutschen Pavillons, wohl fragen, ob Schlingensief ohne Schlingensief nicht noch schlimmer und unmöglicher ist als Beuys ohne Beuys. Ach, Christoph, viel zu früh hat Dich dieser verdammte Lungenkrebs, dem Du seit 2008 tapfer Paroli geboten hast, aus unserer Mitte gerissen. Dass Du uns fehlen wirst, ist eine beschissene Trauerformel, die ich Dir auch postum nicht zumuten kann. Aber Du sollst oben, auf Wolke 24, oder unten, in Satans Feuer, unbedingt wissen, dass wir jetzt schon ahnen, wie groß der Verlust ist, wie sehr die internationale Kulturszene leiden wird, weil einer ihrer bedeutendsten Impulsgeber und Querdenker abgetreten ist.
Als Du mir vor Monaten geschrieben hast, dass »diese Scheißmetastasen wieder im Anmarsch sind«, dass »diese kleinen Wachstumseuphoriker«, denen Du zuvor schon den kompletten linken Lungenflügel opfern musstest, erneut ihr Unwesen treiben, auch eine weitere Chemo schiefgelaufen sei, da nahm ich, ebenso hilflos wie andächtig, den Ausdruck dieser E-Mail – und hängte ihn kurzerhand an die Wand neben meinem Schreibtisch, direkt unter das gerahmte Foto jenes kräftig schlagenden Organs, das ich kurz vor dem Ausbruch Deiner Krankheit dank einer Herztransplantation in allerletzter Minute erhalten hatte. Weißt Du noch, Christoph, wie wir 2008, in den ersten Monaten nach Deiner Operation, pausenlos hin- und hermailten, um uns auf Teufel komm raus auch über intimste Gefühle auszutauschen, uns Mut zu machen?
Nun muss ich heute die letzte Seite unserer Korrespondenz verfassen, ein finales Kapitel aufschlagen, nämlich Abschied nehmen. Kettensägenmassaker quasi. Aber wie Dich würdigen, wie das alles fassen, was Du geleistet hast, wie sehr Du den engen Kunstbegriff gedehnt und teils auch überdehnt hast? »Scheitern als Chance« – ahnst Du eigentlich, wie sehr diese von Dir verbreitete Parole neues Denken eingeleitet hat? Das Schwache, das wenig oder gar nicht Erfolgreiche – ja, diese gesellschaftlich einst verpönten Verliererqualitäten wurden nach und nach tatsächlich als Möglichkeit begriffen, nicht nur von Deinen Kollegen, den Künstlern, das Leben aus dem Normativen der täglichen Karriererituale zu befreien und ins Werteregister einer anderen Art aufzunehmen. Sensationell obendrein, wie Du, der so oft auch von mir in Bezug auf einzelne Vorhaben scharf Kritisierte, die Disziplinen überspannt und kleinbürgerliches Spartendenken abgeschüttelt hast. Film, Theater, Oper, Literatur, bildende Kunst – Hand in Hand, Arm in Arm, Kopf an Kopf oder Arsch zu Arsch. Der Fauxpas am laufenden Meter.
Dabei kommen wir beide aus dem biedersten Bürgertum, wir, die Einzelkinder, Söhne von Müttern, die Anni heißen und uns – im Abstand von sieben Jahren – jeweils exakt am 24. Oktober auf die Welt brachten, ohne zu wissen, dass wir weder Apotheker noch Postbeamte werden wollten. Als Schmalfilmer, Abteilung Super 8, oder als Messdiener, Weihrauchfässer bevorzugt, gingen wir unsere ebenso getrennten wie gemeinsamen Wege – Du in Oberhausen, ich, der Ältere, im hessischen Hanau. Mannomann, was konnten wir da nicht alles zufällig an Dualitäten entdecken. Eine Zeit lang dachte ich, sorry, Du verarschst mich; es könne doch gar nicht sein, dass es jemand gibt, der meine eigene Biografie, jedenfalls die Eckdaten, beinahe deckungsgleich selbst zu bieten hat. Zweifelsfrei hat uns dieser familiäre, ähnlich gezeichnete Pfad verbunden, auch heikle Phasen überstehen lassen, in denen Du aus dem Füllhorn der Perfidie gezaubert hast, was das Zeug hielt und unsere Beziehung gerade noch ertrug.
Ich habe lernen müssen, dass Du nicht Gabriele und mich, die wir Dir einen gut dotierten Inszenierungsauftrag verschafft hatten, persönlich verletzten wolltest, sondern dass Deine unbarmherzigen, grenzwertigen, auch unsozialen, gar unmenschlichen Methoden, nicht selten als Kunst getarnt, gegen ein System gerichtet waren, das Dir fragwürdig erschien. In der Rolle des alerten, höflichen Schwiegersohns hast Du aber, ob bei den Wagners in Bayreuth oder auf dem roten (Berlinale-)Teppich im heimischen Berlin, häufig den Eindruck erweckt, als sei Dir dieser gesellschaftliche Glanz-und-Gloria-Betrieb durchaus recht. Ja, ein Schauspieler, auch ein Menschenspieler warst Du, lieber Christoph, und Gabriele sagte oft, bevor sie wegen Deiner Krankheit eine gewisse Milde im Urteil Dir gegenüber entwickelte, ein solcher Falschspieler könne später nur in der Hölle schmoren. Das sei gerecht.
Gehen wir aber heute, einen Tag nach Deinem unsäglichen, uns alle traurig stimmenden Exodus aus der Kulturwelt, einmal hoffnungsvoll davon aus, dass Du schließlich doch oben landest, allein wegen Deiner guten Taten zuletzt, in Afrika. Mithin Burkina-Faso-Ablass. In Deinem Buch So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein! hast Du erstaunlicherweise eingeräumt, dass es diverse Regeln gibt. »Man darf eine gewisse Grenze nicht überschreiten«, so heißt es auf Seite 175, »sonst öffnet man die Tür zur eigenen Auflösung.« Was Wunder, dass Du, der Du von vielen Menschen als ein rücksichtslos von seinen Ideen besessener Künstler eingestuft wirst, inklusive der umstrittenen Arbeit mit den behinderten »Freakstars«, gelegentlich auch den weichen Kern in Dir wahrnehmen konntest.
Ausgerechnet am Heiligabend 2007, keinesfalls ein Zufall, wie ich meine, schriebst Du, der Schweinehund, Gabriele und mir eine Art Entschuldigung für eine vorausgegangene, überaus strapaziöse und Deinerseits äußerst hinterhältige Zusammenarbeit an der Berliner Volksbühne; dieses Projekt sei »nicht gerade die Krönung meiner sportlichen Aktivitäten« gewesen, so Deine Zeilen. Das hatte wahre Größe, ganz im Gegensatz zum feigen Rückzug im Februar 2005, den wir so schnell nicht vergessen werden. Die Lektion hatte es in sich und wir waren außer uns. Mein damals schon schwaches Herz zuckte.
Was bleibt, lieber Christoph, ist die tiefe Erinnerung an einen Menschen, der – wie nur wenige – durch sein unermüdliches Schaffen, ob konstruktiv oder zerstörerisch orientiert, immer wieder zeigte, was Kunst kann, sein sollte, sein könnte. Ein existenzieller Gratwanderer warst Du, ein Drahtseilartist, der keine Höhe scheute – freilich allzeit im Bewusstsein, dass die Gefahr des Absturzes dialektisch mit jedem Höhenflug gekoppelt ist. Konntest Du länger, als es die Schwere Deiner Krankheit eigentlich erwarten ließ, im Rausch der Inszenierungen des Lebens und des Todes Deine akrobatischen Übungen lautstark auf Erden oder einige Meter darüber machen, so ist nun die ewige Ruhe angesagt. Weg mit dem Megafon! Stille – auch jetzt, draußen, an diesem Sonntagmorgen, kurz nach zehn. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages auf Wolke 24. Dann kannst Du, Skorpion-Bruder, mir endlich die Frage beantworten, warum Dein Giftstachel länger war als meiner und ob sich, im Rückblick, Deine Scherenattacken gelohnt haben, persönlich und gesellschaftlich. Diese Bilanz fehlt noch. Nachsitzen, Christoph! Herzlichst, Dein Carlo
Karlheinz Schmid für Christoph Schlingensief. Nachruf. KUNSTZEITUNG 169, September 2010.
Vorab-Veröffentlichung aus der Publikation zum Deutschen Pavillon 2011 © Deutscher Pavillon 2011, Kiepenheuer & Witsch